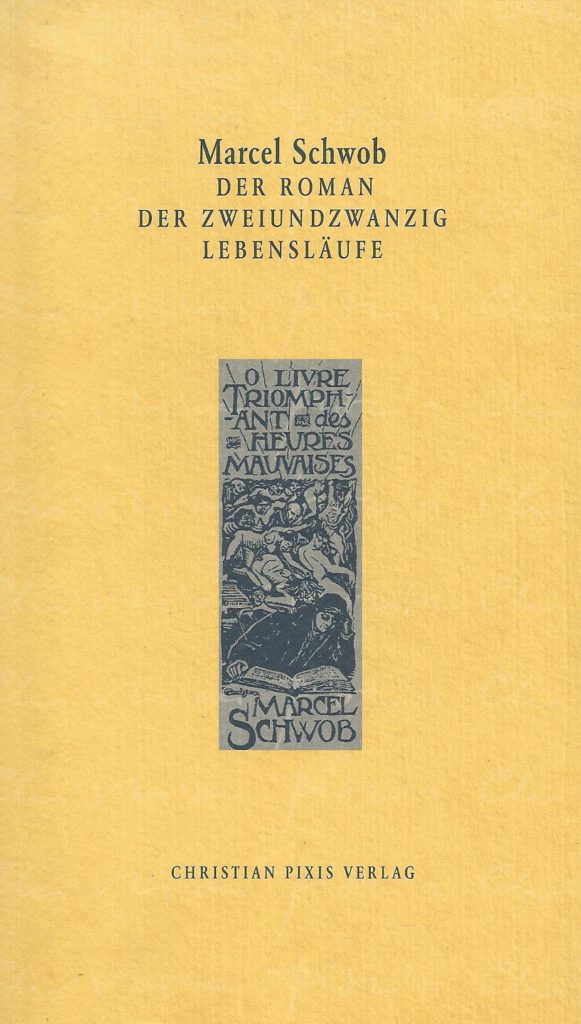
„Es stimmt, daß er einmalig war, und daß dieses
Wort vielleicht alles zusammenfassen könnte,
was sich über ihn sagen läßt.„
Paul Léautaud
In der Ahnengalerie der Moderne sucht man das Bildnis Marcel Schwobs (1867-1905) vergebens. Als einer Zentralgestalt der Dècadence-Literatur ist der französische Autor immer ein Geheimtip geblieben, und jeder Generation war es neuerlich vorbehalten, ihn wiederzuentdecken. In allen Weltteilen würden sich verschworene Gruppen glücklicher Leser finden, bemerkte Jorge Luis Borges, der den Kinderkreuzzug Schwobs übersetzte, und gab an, seine Universalgeschichte der Niedertracht (1935) sei ohne die Lektüre des Erzählgenies nie entstanden: „Er hat nicht den Ruhm gesucht; er schrieb absichtlich für die happy few, für die Wenigen“. Tatsächlich ist Schwob vor allem ein Dichter der Dichter geblieben; jene allerdings verehrten ihn als Berater, Vorbild und Inspirationsquelle gleichermaßen. Nicht von ungefähr widmete der enge Freund Oscar Wilde Schwob seine Salomé. Alfred Jarry eignete ihm seinen Ubu Roi und ein Kapitel des „pataphysischen“ Abenteuerromans Doktor Faustroll zu (bezeichnenderweise das, in dem Kapitän Kid eine gewisse Rolle spielt). Francis Jammes wollte Schwob auf einer Stufe mit Stéphane Mallarmée und André Gide stehen sehen; André Breton und Luis Aragon bezogen ihn in ihre Überlegungen zum Surrealismus ausdrücklich mit ein. „Er gehörte zu der nahezu ausgestorbenen Rasse derer, die auf ihren Lippen stets ein paar wohlriechende Worte haben“, sagte Remy de Gourmont. Und Samuel Beckett bemerkte in einem Brief an George Reavey, er habe sein Gedicht Serena I im Stil Schwobs geschrieben, als sähe er „den Kristallpalast und Primrose Hill durch den Schleier eines beginnenden Grauen Stars hindurch“. Noch Jean-Paul Sartre erläuterte Thesen seines Essayfragments Mallarmées Engagement mit einem Satz aus dem Vorwort des Romans der zweiundzwanzig Lebensläufe: „Die Kunst widerstrebt den Allgemeinbegriffen, sie stellt nur Einzelwesen dar, will nur das Einmalige“. Gerade auf dieses „Einmalige“ aber waren Werk und Biographie Marcel Schwobs nahezu programmatisch ausgerichtet.
1.
Tatsächlich steht der Lebenslauf des Dichters den zweiundzwanzig von ihm erdachten an Besonderheit in nichts nach. Marcel Schwob wurde am 23. August 1867 in Chaville im Département Seine-et-Oise geboren. Sein Vater war mit Flaubert zur Schule gegangen und mit Théophile Gautier befreundet gewesen; auch hatte er gemeinsam mit Baudelaire am Corsaire Satan mitgewirkt, seine literarische Karriere aber wegen Geldmangels aufgeben müssen und zehn Jahre als Kabinettchef bzw. Außenminister in Ägypten gelebt, bevor er mit dem Ankauf von Le Phare de la Loire zum Leiter der größten politischen Tageszeitung von Tours avancierte. Erzogen wurde Schwob von seinem Onkel, ein Orientalist und Chefbibliothekar der Bibliothèque Mazarine im Palais de l’Institut: Er machte den angehenden Dichter mit Büchern und Manuskripten vertraut und brachte ihm die griechischen Klassiker, mittelalterlichen Hagiographien sowie die Lebensbeschreibungen römischer Staatsmänner nahe. Mit elf Jahren las Schwob Baudelaires Übersetzung der Werke Edgar Allan Poes, der neben Thomas De Quincey und Robert Louis Stevenson ein Leben lang sein Vorbild blieb und mit dem ihn nicht zuletzt das Interesse am Abseitigen, Dämonischen und Dunklen der menschlichen Psyche verband. Während dieser Zeit entstand ein erster Artikel über ein Buch von Jules Verne, der im Phare de Loire erschien. 1882 ging Schwob an das Pariser Lyzeum Louis-le-Grand, wo Paul Claudel, Léon Daudet, Henri Barbusse und Joseph Bédier seine Freunde wurden. (Die Gruppe traf sich zu Kunstgesprächen im Café d’Harcourt, an die sich Claudel noch in den fünfziger Jahren gern erinnerte.) Vor und nach seinem Wehrdienst beim 35. Artillerieregiment in Vannes scheiterte Schwob an der Zulassung zur Ecole Normale, weil er sich nach eigenen Angaben „in einem Ozean von Lektüre“ verlor, statt sich vorzubereiten. Anschließend hörte er Vorlesungen an der Sorbonne (u. a. bei Ferdinand de Saussure) und bestand 1888 die Licence de lettres mit Bravour. Das weitere Studium der griechischen Paläologie bei Michel Bréal allerdings brach er ohne Abschluß ab. Währenddessen machte sich Schwob mit Studien zum französischen Argot (1889) und zu François Villon (1890) einen Namen.
1891 wurde Schwob neben Catull Mendès Leiter der Literaturbeilage des Echo de Paris. Zu ihren Beiträgern gehörte neben Mirabeau, Paul Bourget, Guy de Maupassant, Barrès, Lorrain und Gourmont auch Jarry, als dessen eigentlicher Entdecker Schwob gelten kann (1893 wurde Jarrys erste Erzählung, Guignol, vom Echo de Paris ausgezeichnet). 1891 erschien auch Schwobs eigenes Erzähldebüt, die aus vierunddreißig – Stevenson gewidmeten – Novellen bestehende Sammlung Coeur Double; bereits hier wird Weltgeschichte als skurriles Panoptikum vorstellt. Coeur Double machte ihren Verfasser nicht nur innerhalb der Pariser Bohème mit einem Schlag berühmt und wies ihn aus als wichtigstes Talent des Fin de siècle. Es folgten Le Roi aus masques d’or (1892), Mimes (1893), Le Livre de Monelle (1894), La Croisade des enfants (1894), Les vies imaginaires (1896), die Essaysammlung Spicilège (1896), La porte des rêves (1899), La Légende de Serlon de Wilton (1899), La Lampe de Psyché (1903) und die Journalistensatire Moeurs des Diurnales, traité du journalisme (1903), letztere unter dem Pseudonym Loyson-Bridet. Übersetzungen von Shakespeares Hamlet (1900) und Marion Crawfords Francesca da Rimini (1902) wurden von Sarah Bernhardt aufgeführt. Die Übertragung von Daniel Defoes Verbrecherinnenroman Moll Flanders von Daniel Defoe 1895 lehrte Schwob das Prinzip der lockeren Kapitelreihung und den Sinn für scheinbar Nebensächliches, der auch den Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe bestimmt.
1900 heiratete Schwob die Schauspielerin Marguerite Monceau (1871-1948), die unter dem Künstlernamen Moreno versuchte, erfolgreich zu sein. Zur neubezogenen Wohnung auf der Ile Saint-Louis mitten in Paris gehörte auch der chinesische Diener Tsing-Tsé-Ying, der zuvor im Pavillon seines Heimatlandes bei der Pariser Weltausstellung von 1900 angestellt gewesen war und mit dem Schwob, Gerüchten zufolge, eine homoerotische Liebschaft unterhielt. Schwobs mit Büchern und Papieren vollgestopfte Wohnung wurde bald schon das Zentrum der literarischen Avantgarde; aber auch im Quartier Latin und im Café François stellte der poeta doctus neben Paul Verlaine den intellektuellen Mittelpunkt dar. Die Ehe mit der Moreno soll nicht glücklich gewesen sein, und Schwob scheint bezahlte Affären seiner Ehefrau nicht nur geduldet, sondern gar forciert zu haben, um die leere Haushaltskasse mit Geld zu füllen. Schwob selbst suchte in den Cafés des Montmartre die Nähe von Zuhältern und Dirnen; die Beziehung zu der jungen Prostituierten „Louise“ half ihm über persönliche Krisen hinweg. Nach ihrem frühen Tod fühlte er sich zusehends allein. Als jene Krankheit neuerlich ausbrach, die Schwob sich auf einer Reise nach Samoa und in den Orient zugezogen hatte, war der Dichter durch seine Morphiumsucht zu geschwächt, um sie zu besiegen.
In einem Nachruf berichtet Paul Léautaud, der Schwob 1903 kennenlernte und ihm Zeit seines Lebens in kollegialer Haßliebe verbunden blieb, von einer letzten Begegnung mit dem Dichter. Vierzehn Tage vor seinem Tod hatte er „jenem kleinen, schmächtigen Mann, schon leicht gebeugt, mit einem wundervollen Kopf, über den das Leiden sozusagen Schlittschuh gelaufen war“, nochmals getroffen. Wie jeden Tag sei er kurz vor fünf Uhr aus Bibliotheken und Archiven zurückgekommen, voller Arbeitseifer, ausgerechnet er, „der für gewöhnlich so kränklich und so kraftlos“ gewesen sei: „das Gesicht bartlos, die Stirn wie ein weißer Turm, die Augen gedankensprühend, der Mund geschwungen und ausdrucksvoll“. Gerade hatte man Schwob – nach seiner spektakulären Vorlesung über Francois Villon Ende 1904 an der École des Haute Etudes sociales – einen Lehrstuhl für vergleichende Literaturwissenschaft an der Sorbonne in Aussicht gestellt, und der Gedanke an mehrere literarische Projekte gab ihm offensichtlich Hoffnung, der Krankheit durch schöpferische Arbeit doch noch Herr werden zu können. Aber die Wirklichkeit holte den Imaginisten bald schon ein. Am 26. Februar 1905 starb Marcel Schwob, erst 37-jährig, in Paris. Er liegt auf dem jüdischen Teil des Cimatière du Montparnasse begraben. Bei der Beerdigung folgten neben Léautaud u. a. Jules Renard, Prudhon und Paul Valéry dem Sarg. Renard notierte in seinem Tagebuch eine fiktive Leichenrede in der Ich-Form. Sie gipfelt in einer Drohung an die Nachwelt, die Einmaligkeit des Verstorbenen nicht zu vergessen: „Hütet Euch, mir gleichen zu wollen!“
2.
Niedergedrückt von „der Schwermut eines Menschen, dem nichts mehr neu war“ (Léautaud), begann der oftmals als wandelnde Bibliothek apostrophierte Schwob schon früh, sich eigene Welten zu erdichten. In der Literatur eröffnete sich ihm auch die Möglichkeit einer fiktiven Selbstentgrenzung. André Gide berichtet in seinen Tagebüchern, Schwob habe die Spiegel in seiner Wohnung auf der Ile Saint-Louis verhangen, um nicht permanent mit seinem „unerträglichen“ Ich konfrontiert zu werden; in diesem Sinn sind seine Romane und Erzählungen nicht zuletzt der Versuch, die eigene Biographie durch Literatur zu bereichern. „Ich empfand die schmerzliche Sehnsucht, mich mir selbst zu entfremden“, heißt es in einer der Erzählungen von Coeur Double: „oft wollte ich Soldat sein, ein armer Mann oder ein Kaufmann oder einer Frau, die ich vorübergehen sah“: Fast könnte man meinen, der Autor spreche hier von sich selbst. So sind auch die Zweiundzwanzig Lebensläufe Ausdruck des Verfasserwunsches, innere Grenzen zu überschreiten und zugleich die Fesseln der profanen Wirklichkeit mit Phantasie zu sprengen. Überzeugt von dem Gedanken, „daß alle Dinge auf der Welt nur Zeichen sind und Zeichen von Zeichen“ (so formuliert in Der König mit der goldenen Maske), gerät die Realität zum Material, Tatsächliches in imaginären Biographien fortzudichten. „Zur Abfassung des Buchs erfand er eine merkwürdige Methode“, schrieb Borges bewundernd: „Die Protagonisten sind real, die Fakten sind oft fabelhaft und nicht selten phantastisch. Der eigenartige Geschmack des Werks liegt in diesem Pendeln“. Der französische Originaltitel des Romans, Vies imaginaires, trägt diesem Umstand ständigen Changierens zwischen Fakt und Fiktion eher Rechnung als Jakob Hegeners ansonsten kongeniale Übersetzung aus den zwanziger Jahren. In einem den Zweiundzwanzig Lebensläufen vorangestellten Vorwort hat Schwob dieses innovative Erzählverfahren einer exakten Einbildungskraft vorgestellt und den Aufgabenbereich des (eher wissenschaftlich interessierten) Geschichtsschreibers und den des Biographen klar voneinander abzugrenzen gesucht. Letzterer wähle „aus dem menschlich Möglichen das Einmalige aus“ – und wird so für Schwob mit dem Dichter synonym. In den Zweiundzwanzig Lebensläufen gehen scharfe Analyse, enzyklopädische Leidenschaft und synthetische Schöpferkraft nahtlos ineinander über. Das Kapitel über den Renaissancemaler Paolo Ucello formuliert die Idee und setzt sie gleichzeitig literarisch um: „Ucello kümmerte sich eben nicht im mindesten um das, was wirklich war, sondern nur um die Unendlichkeit der Umrisse“, heißt es da. Und weiter: „In der Folge ließ Ucello […] alle Formen in den Schmelztiegel der Form eingehn. Er tat sie zusammen, er verband sie und goß sie um, er wollte ihre Wandlung in die einzige Urform erlangen, aus der alle anderen ableitbar sind“. Bei dieser Technik verdampft alles Überflüssige; nur das Wesentliche bleibt zurück. Dieses Prinzip schafft jene Einheit, die die zweiundzwanzig episodischen Kapitel zusammenhält und die zunächst merkwürdig erscheinende Gattungsbezeichnung als „Roman“ erst rechtfertigen kann.
Tatsächlich stehen die einzelnen Kapitel des Romans der zweiundzwanzig Lebensläufe zunächst recht heterogen nebeneinander. Geschildert werden die gemutmaßten Biographien von Göttern und Verbrechern, Ketzern und Zynikern, Verächtern und Verachteten, Gauklern und Hexen, Heiligen und Verbrechern, Dichtern und Dirnen, deren Leben zumeist ein (grausamer) Tod beendet. Auch den Vorbildern der eigenen Jugend, wie Empedokles und Lukrez, sind Kapitel gewidmet, wobei verbürgte und berühmte Personen neben gänzlich Unbekannten stehen: „Die Kunst des Beschreibens müßte das Leben eines armen Schauspielers ebensoviel Gewicht verleihn wie dem eines Schauspielers“. Wichtig ist allein das Regelwidrige der Existenz. Neben der stilistischen Komponente schafft diese extreme Außenseiterrolle der Figuren eine gewisse inhaltliche Konsistenz. Konsequent verlagert Schwob die für den Roman typische Dramaturgie einer fortlaufenden „Handlung“ auf die Erzählperspektive, die sich im Verlauf des Buches beständig wandelt und das „tragische“ Element der beschriebenen Ausnahmeexistenzen immer stärker ironisiert. So entwickeln die Zweiundzwanzig Lebensläufe eine ganz und gar originäre Dynamik, die sich allein der Sprache verdankt.
Vor allem nämlich erzählt Schwobs Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe von der wundervollen, fast magischen Kraft der Worte, ähnlich jenen Beschwörungsformeln der Sklaventochter und Zauberin Septina, die sie mit ihrem Geliebten Sextilius im Totenreich vereinen helfen und, auf einem Bleitäfelchen zusammengefaßt im Grab ihrer Schwester versenkt, der Nachwelt überliefert sein sollen. Nicht von ungefähr erkennt der Zyniker Krates seine wahre Bestimmung im Theater bei einem Stück des Euripides. Dem Dichter Lukrez eröffnet sich die Erkenntnis der Welt durch die Lektüre des Epikur, und der zwielichtige Inquisitor Klaus Loyseleur bringt mit seiner verführerischen Überredungskunst eine Unschuldige auf dem Scheiterhaufen. Der alphabetische Geomant Sufrah gar läßt kraft seiner Worte die Erde beben. Und nachdem eine „gewaltige Stimme“ den göttlichen Empedokles wie ein Deus ex macchina beim Namen nennt, verschwindet er, ohne jemals wieder sichtbar zu werden. Die symbolistische Idee vom autonomen Sprachkunstwerk formuliert das Kapitel des Götzenzertrümmerers Herostrat, von dem die Sage nur den Namen überliefert hat und der nicht zuletzt „ein Kind seines eigenen Werkes“ ist. Vor allem aber Oscar Wildes herrliches Aperçu, daß das Leben die Kunst nachahme und nicht umgekehrt, schimmert immer wieder durch. Als der Sklave Syrus und der Geschichtenerzähler Petron beschließen, die eigene Dichtung nachzuleben, gewinnt dieser Leitgedanke des Ästhetizismus allegorische Gestalt. Ironisch gebrochen erscheint er in der wunderbar verspiegelten Hamlet-Variante des Kapitels um die Figur Gabriel Spencers oder in Gestalt Major Stede Bonnets, der als Seeräuber von der traurigen Gestalt seine Identität nach der Lektüre von allerlei Piratengeschichten gänzlich aufgibt und seine Existenz als Farce am Galgen aushaucht. Auch der Tod des genialischen Halbgotts Cyril Tourneur ist begleitet von Trauerfanfaren „wie im Theater“, welche Literatur und Biographie auf tragikomische Weise verschmelzen machen. Im letzten – und vielleicht humoristischsten – Kapitel über die Herren Burke und Hare dann wird der Mord als schöne Kunst betrachtet, wobei den Opfern die Rolle einer scheiternden Scheherezade zukommt. Die Geschichten der Delinquenten aber dauern nicht tausendundeine Nacht, sondern werden bereits nach wenigen Stunden durch den Tod der Sprecher unterbrochen: Gemordet wird, „um den Faden der Erzählung zu unterbrechen“, wie es heißt. Indem es die Kunstposition des Fin de siècle kritisch-ironisierend hinterfragt, ohne freilich moralisierend zu werden, untergräbt Mister Burkes grausames Stegreiftheater am Ende das eigene Dichtungskonzept. Damit aber weist Schwobs intelligenter Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe weit über seine Zeit hinaus und hin zur surrealistischen Literatur.
„Ausgerüstet mit der induktiven Phantasie eines Edgar Poe und dem minutiösen Scharfsinn eines in Textanalysen bestens bewanderten Philologen besaß [Schwob] zugleich eine eigenartige Leidenschaft für Ausnahmeexistenzen, für Menschen, die sich mit gewohntem Maß nicht messen lassen, eine Leidenschaft, die ihn so manches Buch entdecken und so manchen literarischen Wert setzen ließ“, schrieb Paul Valéry in seinem dem Dichter gewidmeten Essay über Villon und Verlaine. Schwob habe ihn begreifen gelehrt, „daß es ein Genie des Forschens gibt und ein Genie des Findens, und sein Genie des Lesens wie ein Genie des Schreibens„. Wie es scheint, haben sich in der Gestalt Marcel Schwobs all diese Fähigkeiten aufs Wunderbarste vereinigt. Überleben würden die kleinen Bücher und solche Autoren, die wenig geschrieben hätten, äußerte Schwob einmal im Gespräch gegenüber Paul Léautaud: „was Baudelaire angehe, so sei er unbesorgt“. Im seinem eigenen Fall wird sich dieser Satz hoffentlich noch beweisen.
München, im September 1997, Thomas Köster
