„Kippenbergers Kosmos steckt im ‚Kafka'“
In Essen würdigen zwei (geschlossene) Ausstellungen Martin Kippenberger. Die Galeristin Gisela Capitain war seine engste Vertraute. Ein Gespräch über offene Labyrinthkunst, Plakate als Romane und dadaistischen Sprachwitz. Über das Gesamtwerk als Bewerbungsmappe. Und was Kafka damit zu tun hat.
KunstArztPraxis: Frau Capitain, Kippenbergers Installation „The Happy End of Franz Kafka’s ‚Amerika'“ im Museum Folkwang zitiert jene Romanszene, in der Kafkas Held sich für das mysteriöses Naturtheater von Oklahoma bewirbt, um vom Leben in die Kunst überzuwechseln. Wie Kippenberger?
Gisela Capitain: Nein. Kippenberger musste nicht überwechseln. Er hat sich ja schon mit fünf Jahren als Künstler verstanden. Für Kippenberger schrieb sich sein Leben sofort in seine Kunst ein. Beides war für ihn eine Einheit.
Und das mit einer alle Medien umfassenden Präsenz, wie sie am besten in seiner Kafka-Installation in Essen zum Ausdruck kommt.

Einstieg in den ganzen Kippenberger
KunstArztPraxis: Anders als im „Amerika“-Roman besteht die Bewerbungsszenerie bei Kippenberger nicht aus kleinen, labyrinthisch angeordneten Räumen, sondern aus kompletter – allerdings nicht weniger labyrinthischer – Offenheit. Warum?
Gisela Capitain: Das ist ein typisches Merkmal bei Martin Kippenberger: dass alle seine Werke offene, nicht abgeschlossene Denkmodelle sind, mit denen er sich bei seinem Publikum bewirbt. Das kann der Museumsbesucher sein, die Kunstkritik oder jede andere Instanz oder Person des Kunstbetriebs.
Tatsächlich ist dieses Riesenfeld mit seinen Stuhl-Tisch-Kombinationen in Essen ein möglicher Einstieg in all das, was Kippenberger vor der Entstehung dieses Werkes und in den anderthalb Jahren danach geschaffen hat. Objekte, Malereien, Installationen, Skulpturen, Bücher, Kataloge, Plakate, Musik, literarische Texte: Alles ist irgendwie enthalten.

Gleichzeitig ist die Kafka-Installation auch eine Auseinandersetzung mit allen möglichen kulturellen, gesellschaftspolitischen und kunsthistorischen Themen, die Kippenberger seit den späten 60er Jahren geprägt haben und die er auf seine Weise in sein Werk integriert hat.
Kippenbergers Kosmos, sein vielschichtiges Denken ist darin verwoben. Und das Ganze entwickelt und inszeniert mit einer unglaublichen visuellen Vorstellungs- und Bildkraft, die grundsätzlich sehr wesentlich für sein Schaffen ist.
„Künstlerwerden wollte niemand,
FRANZ KAFKA, „AMERIKA“ (1927)
wohl aber wollte jeder für seine Arbeit bezahlt werden.“
Die Installation als Jahrhundertroman
KunstArztPraxis: Klingt nach einem gigantischen erzählerischen Opus Magnum…
Gisela Capitain: … und zwar von einer Vielfalt und Komplexität, mit der man eigentlich erst einmal gar nicht klarkommen kann. Da muss sich der Betrachter stückweise durcharbeiten und immer wieder neue Anregungen aufnehmen.
Nicht umsonst war Kippenberger fasziniert von einem Jahrhundertschriftsteller wie Robert Musil. Und nicht umsonst ist der Schreibtisch, an dem Musil seinen Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ geschrieben hat, Teil der Installation. Ein Verweis auf Kippenbergers Vorhaben, ein ähnlich allumfassendes Werk in der bildenden Kunst zu produzieren.

Ein offen-labyrinthisches Angebot
KunstArztPraxis: Bei Kippenberger sind wir dann wohl auch bei Musils Modell eines essayistischen Schreibens, das in seinen unterschiedlichen Lesbarkeiten ja stark auf einen aktiven Rezipienten setzt …
Gisela Capitain: Wie KIppenbergers Kafka-Installation, die als offen-labyrinthisches Denkmodell sehr stark dem Betrachter zugewandt ist. Vergleichbar dem Angebot in Kafkas Roman: Das Theater von Oklahoma bietet Jedem einen Job, wenn er nur Interesse hat. Jeder kann hier Künstler werden. Jeder kann seine eigene Vorstellung dazu entwickeln.
Eine utopische Idee, die Kippenberger dem Betrachter seiner Kafka-Installation anbietet. Das entspricht auch seiner immerwährenden öffentlichen Bewerbung als Künstler.
„Wer Künstler werden will melde sich!
FRANZ KAFKA, „AMERIKA“ (1927)
Wir sind das Theater, dass jeden brauchen kann.“

Das Büro als Bewerbungsmappe
KunstArztPraxis: Wenn man Kippenbergers Büro mit seinen Sitz-Parzellen betrachtet, dann gibt es zur Kafka-Installation einige Parallelen – auch wenn es dort offenbar viel aufgeräumter aussah. Oder?
Gisela Capitain: Ja, das Büro war tatsächlich so etwas wie eine sehr reduzierte Variante der Kafka-Installation, die sehr flexibel war und immer wieder verändert wurde – je nach Veranstaltung. Bei einer Lesung Oswald Wieners sah das Büro anders aus als bei einer Gruppenausstellung oder einem Konzert der Gruppe „Mittagspause“.
Symbol für diese Offenheit und Dynamik war neben dem Mofa, mit dem Kippenberger über die Etage fuhr, sein Schreibtisch. Der stand auf einer Plattform mit Rollen und wurde ständig woanders hingeschoben. Dazu sein Stuhl und bisweilen ein zweiter Stuhl für einen Gesprächspartner.
„Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns!“
FRANZ KAFKA, „AMERIKA“ (1927)
Hier bin ich!
KunstArztPraxis: Klingt so, als sei auch Kippenbergers Büro wie bei Kafka eingerichtet gewesen für Bewerbungsgespräche jedweder Art?
Gisela Capitain: Ja, das stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, war das Büro mit allen Aktivitäten in diesen Jahren in Berlin eine einzige Bewerbung für Kippenberger als Künstler.
Es gab damals die Künstlergruppe der „Neuen Wilden“ mit Rainer Fetting, Helmut Middendorf, Bernd Zimmer und Salomé am Moritzplatz in Kreuzberg, oder die Generation davor um Karl Horst Hödicke und Markus Lüpertz. Kippenberger hat diese Gruppierungen als Herausforderung gesehen und sich sofort in Bezug gesetzt.
Da signalisierte das Büro: Hier bin ich. Martin Kippenberger ist in Berlin. Das ist mein Auftritt, das ist mein Ort, an dem ich mich inszeniere, mit dem ich mich vorstelle und auf sehr provokative Art in Wettbewerb zu euch trete.
„Es gab soviel Plakate,
Franz Kafka, „Amerika“ (1927)
Plakaten glaubte keiner mehr.“
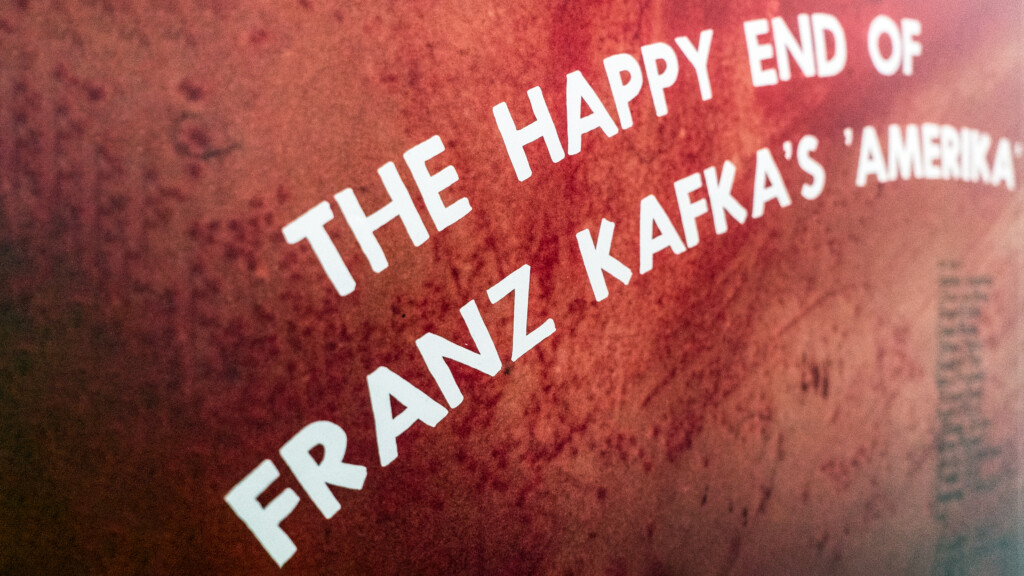
Ein plakatierter Lebenslauf
KunstArztPraxis: Auf das Theater wird Kafkas Held durch ein Plakat aufmerksam, dass er interessanterweise für „noch unwahrscheinlicher hält, als Plakate sonst zu sein pflegen“. In der Villa Hügel ist nun ein Großteil von Kippenbergers über 120 Plakaten zu sehen, die das Museum Folkwang als Komplettsatz besitzt. Warum Plakate? Und warum so unwahrscheinlich viele?
Gisela Capitain: Wie die Ausstellungskataloge, so waren auch die begleitenden Plakate für Kippenberger das, was am Ende von einer Ausstellung übrigbleibt: Das belegt auch die aktuelle Ausstellung eindringlich. Kippenberger war immer enttäuscht, wenn eine Galerie oder ein Museum kein Plakat herstellen wollte, und hat am Ende die Druckkosten lieber selbst bezahlt als darauf zu verzichten.
Für Kippenberger waren die Plakate eigenständige grafische Werke, die als Teil der Inszenierung und Selbstdarstellung illustrierten, was er an welchen Orten und zu welcher Zeit seines Lebens gemacht hat. Man könnte sie auch wie ein Künstlerbiographie lesen. Und andererseits waren sie Bild-Text-Collagen, visuelle Muster, Belege und Dokumente jener Ideen, mit denen er sich im Kontext seiner Ausstellungen befasste.
KunstArztPraxis: Also eine Art Bewerbungsunterlagen für die Nachwelt?
Gisela Capitain: Ist das Schaffen eines Künstlers nicht immer eine Bewerbung für die Nachwelt?
Nachfolger des Dadaismus
KunstArztPraxis: Wenn man durch die Plakate-Ausstellung der Villa Hügel geht, hat man teils das Gefühl, man schlendre durch einen Architektur gewordenen Roman – so verwoben sind die Worte der verschiedenen Blätter in der Gesamtschau der Kapitel miteinander. Wieviel Dichter steckte denn in Martin Kippenberger?
Gisela Capitain: Sprache war für Kippenberger immer ein zentrales Element, nicht nur bei den Plakaten, sondern auch in der Malerei der 80er Jahre. Aber auch bei den Einladungskarten, die in Essen leider nicht zu sehen sind. Ein herausforderndes Spiel und gleichzeitig eine Ernsthaftigkeit, mit der Vieldeutigkeit von Sprache umzugehen.
Die damalige Kuratorin für Zeichnungen und Druckgrafik des New Yorker MoMa, Bernice Rose, hat bereits Mitte der 80er Jahre Werke Kippenbergers für die Sammlung angekauft. Für sie waren Kippenberger und Albert Oehlen mit ihren Bild-Text-Konstruktionen legitime Nachfolger des deutschen Dadaismus.

KunstArztPraxis: Würden Sie das unterschreiben?
Gisela Capitain: Ja, Kippenberger hat sich besonders in den Berliner Jahren sehr für den Dadaismus interessiert; dafür, wie in den Werken der dadaistischen Künstler Sprache mit Bildmaterial verdreht und zerstückelt wird, um alles mit neuer Bedeutung aufzuladen.
Was kann man mit Sprache machen? In welcher Weise kann sie demagogisch oder absurd, grotesk oder zerstörerisch, aber auch versöhnlich wirken? Wie agiert sie mit oder gegen seine Bilderfindungen? Das waren Fragen, die Kippenberger immer beschäftigt haben.
Dabei sind wunderbare Sprüche herausgekommen wie „Was ist ihre Lieblingsminderheit?“ oder „Wen beneiden Sie am meisten?“. Sätze, die nach mehr als dreißig Jahren heute noch Gültigkeit haben. Genauso, wie auch der gesamte „Kafka“ noch aktuelle Bedeutung hat.
Das KunstArzt-Praxis-Quiz: Fit für Kippi?
Fit für Kippi? Das Martin-Kippenberger-Quiz

© für alle Kunstwerke: Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Köln
Gisela Capitain lernte Martin Kippenberger 1977 über ihre Schwester Jenny bei einer Partie von Kippenbergers Lieblingskartenspiel Mau-Mau kennen. Weil sie verlor, musste sie im Berliner Künstlerlokal „Exil“ ihre Spielschulden mit Rotwein begleichen: der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Kurz darauf bezogen beide in Kreuzberg „Kippenbergers Büro“ – bis zur Schließung 1980 ein Hort des kreativen Chaos. Drei Jahre später trafen sich beide in Köln wieder, wo Capitain inzwischen Assistentin von Kippenbergers Galeristen Max Hetzler geworden war. Ihre 1986 gegründete eigene Galerie vertritt bis heute Kippenbergers Nachlass.
Das Handwerkszeug zur Beurteilung guter Kunst, sagt Capitain, verdanke sie ihm.
Anmerkung: Natürlich heißt Franz Kafkas Romanfragment „Amerika“ nicht „Amerika“. Kafkas Freund Max Brod hat es posthum so genannt. Heute heißt das Buch „Der Verschollene“. Aber das konnte Kippenberger nicht wissen. Und es hätte ihn wohl auch nicht interessiert. Angeblich hat er das Buch eh nicht gelesen, sondern sich nur nacherzählen lassen – was wir natürlich nicht so dolle finden.








































































































Kommentare
„Kippenbergers Kosmos steckt im ‚Kafka'“ — Keine Kommentare
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>